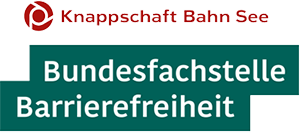Rede von Dr. Volker Sieger in der Beiratssitzung der Bundesinitiative Barrierefreiheit, Fokusthema Bauen/Wohnen
Die nachfolgende Rede hielt Dr. Volker Sieger, Leiter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit, am 15. Oktober 2024 vor dem Beirat der Bundesinitiative Barrierefreiheit in Berlin/online.
Dr. Volker Sieger:
Vielen Dank für die Möglichkeit, heute online dabei sein zu dürfen. Ich möchte Ihnen heute einige Dinge zum Thema Barrierefreies Wohnen berichten. Ich werde zunächst einmal etwas über den Bestand und den Bedarf an barrierefreien Wohnungen sagen, werde dann etwas über Mehrkosten ausführen und schließlich über die Landesbauordnung sprechen – also das, was in der Hoheit der Länder liegt. Ich werde auch noch zu dem einen oder anderen Vorschlag kommen, wie man barrierefreien Wohnraum insgesamt in Deutschland fördern kann.
Bestand und Bedarf
Kommen wir zunächst einmal zum Bedarf an barrierefreiem Wohnraum: Spätestens seit der repräsentativen Erhebung im Rahmen des Mikrozensus 2018 wissen wir, dass der Bestand an barrierefreien, altersgerechten oder auch nur barrierereduzierten Wohnungen in Deutschland weniger als zwei Prozent der insgesamt rund 37 Millionen Wohnungen ausmacht. Damit fehlen heute bereits weit über zwei Millionen Wohnungen dieser Art. Und wir reden hier nicht über zwei Millionen barrierefreie Wohnungen nach DIN-Norm, sondern lediglich über die vom Mikrozensus erhobenen Wohnungen, die also nur bestimmte Merkmale der Barrierefreiheit aufweisen.
Wir wissen seit langem, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Obwohl in den vergangenen Jahren mehr barrierefreier Wohnraum entsprechend der verschiedenen Landesbauordnungen geschaffen wurde – auch das ist dem Mikrozensus zu entnehmen –, werden wir auch in zehn Jahren noch mehr als zwei Millionen barrierefreie, altersgerechte Wohnungen zusätzlich brauchen. Das geht aus Prognosen hervor, die das Bundesbauministerium vor einigen Jahren in Auftrag gegeben hatte. Der Fehlbestand wird also auch in zehn Jahren noch in etwa in der gleichen Größenordnung vorhanden sein.
Das sind zunächst einmal die reinen Zahlen. Dass sie eine gesellschaftspolitische Dimension haben, verdeutlicht ein kleiner Verweis auf Artikel 19 der UN-Behindertenkonferenz. Darin wird Menschen mit Behinderung eine unabhängige Lebensführung und die Einbeziehung in die Gemeinschaft zugestanden sowie das Recht zugesprochen, gleichberechtigt ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben möchten. Das bedeutet: Verfügen wir nicht über zusätzliche zwei Millionen barrierefreie Wohnungen, ist im Kern die Freizügigkeit von Menschen mit Behinderung ganz eklatant eingeschränkt. Und wir würden sehenden Auges akzeptieren, dass diese Freizügigkeit für Menschen mit Behinderung auch in zehn Jahren noch ungefähr auf dem Niveau von heute eingeschränkt sein wird.
Dieser Sachverhalt hat bereits 2018 vermutlich dazu geführt, dass die Behindertenbeauftragten des Bundes und der Länder in ihrer „Hamburger Erklärung“ für den Geschosswohnungsbau in Deutschland gefordert haben, nur noch barrierefreie Wohnungen zu errichten. Davon sollte eine angemessene Zahl an Wohnungen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zugänglich sein.
Aus meiner Sicht hat ein wesentliches Argument in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass Barrierefreiheit nicht entsprechend der objektiven Notwendigkeit umgesetzt wurde: die Diskussion um die realen oder vermeintlichen Kosten für barrierefreien Wohnraum.
Kosten
Eine Studie aus dem Jahr 2015, die von der Baukostensenkungskommission in Auftrag gegeben wurde, hat einiges zur Verunsicherung beigetragen. Damals wurde festgehalten, dass die Mehrkosten für barrierefreien Wohnraum zwischen null und 20 Prozent liegen können. Von dem Zeitpunkt an argumentierten all diejenigen, die sich eher dagegen ausgesprochen hatten, mehr barrierefreien Wohnraum zu schaffen, bedauerlicherweise nicht mit der Zahl Null, sondern mit der Zahl 20, den vermeintlichen 20 Prozent Mehrkosten. Diese Studie ist jedoch methodisch so undurchsichtig, dass nicht wirklich in Erfahrung gebracht werden konnte, welche Kosten eigentlich seinerzeit eingerechnet wurden. Waren es tatsächlich zusätzliche Kosten oder waren es bestimmte Kosten wie beispielsweise der Aufzug, der in dem Fall komplett den Kosten der Barrierefreiheit zugeschlagen wurde? Rechnen Sie die Gesamtkosten eines Aufzugs komplett als Posten einer barrierefreien Maßnahme, sind das viel höhere Mehrkosten, als tatsächlich entstehen. Gerade im Wohnungsbau werden viele Wohnhäuser heute grundsätzlich mit Aufzug geplant und gebaut oder müssen nach ihrer jeweiligen Landesbauordnung mit Aufzug gebaut werden.
Im selben Jahr hat eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung Bürogebäude untersucht. Sie ist ebenfalls zu dem Ergebnis einer Bandbreite von null bis 20 Prozent Mehrkosten für Barrierefreiheit gekommen. Die Autoren hatten in dieser Studie jedoch die Kosten dahingehend aufgeschlüsselt, dass der Mehraufwand bei kleineren Bürogebäuden bei 2,6 bis 20 Prozent liege, im Mittel aber nur bei 4,87 Prozent. Bei größeren Bürogebäuden lägen die Mehrkosten auch nur bei null bis 4,46 Prozent, im Mittel sogar nur bei 1,19 Prozent. Das heißt, alleine die Größe eines Bürogebäudes war hier schon entscheidend, ob die Mehrkosten für barrierefreies Bauen eher bei null Prozent oder eher bei 20 Prozent liegen.
Meiner Ansicht nach war die Diskussion, die im Jahr 2015 mit diesem Wert von 20 Prozent entstand, nicht förderlich für das gesamte Thema rund um die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum.
Andere Studien, die im Nachgang publiziert wurden, lieferten durchaus andere Ergebnisse. Beispielsweise ermittelte eine Studie in Hamburg im Jahr 2017 Mehrkosten für Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 in Höhe von 1,7 Prozent - allerdings ohne den R-Standard der DIN, also barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar.
Eine weitere Studie aus dem Jahr 2017, die sogenannte Terragon-Studie, entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Dort sind Mehrkosten von nur 1,26 Prozent errechnet worden. Bezogen auf die Gesamtinvestition waren es sogar nur Mehrkosten von 0,86 Prozent.
Es gab in den Folgejahren weitere Studien in diesem Bereich. Jürgen Dusel, der Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, hielt 2022 eine Regionalkonferenz zusammen mit der Bundesarchitektenkammer ab. Dort sprach ein Sachverständiger von Mehrkosten von unter einem Prozent.
Auf der Fachkonferenz der Bundesfachstelle Barrierefreiheit „Mehr barrierefreien Wohnraum schaffen!“ im Februar 2024 in Erfurt wurde ein Projekt aus Krefeld mit 146 Wohnungen - davon einige wenige Wohnungen sogar nach dem sogenannten R-Standard - vorgestellt. Die Mehrkosten dort wurden mit 1,61 Prozent angegeben. Zu erkennen ist, dass bei frühzeitiger Planung die Mehrkosten für nach der DIN errichtetem barrierefreien Wohnraum zwischen null und einem Prozent beziehungsweise zwischen einem und zwei Prozent liegen - je nachdem, ob uneingeschränkt oder nicht uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar.
Landesbauordnungen
Betrachten wir die Landesbauordnungen der 16 Bundesländer, müssen wir feststellen, dass nach wie vor sieben Bauordnungen lediglich den Minimalstandard der Musterbauordnung erfüllen, der wiederum seit mehr als 20 Jahren nicht verändert wurde. Der Mindeststandard der Musterbauordnung besagt, dass barrierefreie Wohnungen nur in einem Geschoss bereitgestellt werden müssen.
Die Situation in Deutschland ist aber insgesamt sehr uneinheitlich. Neben den erwähnten sieben Ländern gibt es Bundesländer, die weit über die Musterbauordnung hinausgehen, die mehr barrierefreie Wohnungen fordern oder darüber hinaus Wohnungen, die uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sind.
Wie kann aus Sicht der Bundesfachstelle Barrierefreiheit mehr Dynamik in die ganze Angelegenheit kommen?
Natürlich braucht es einen Dialogprozess zur Musterbauordnung und zur Verbesserung der einzelnen Landesbauordnungen.
Dann besteht die Möglichkeit, die Bauleitplanung über das Baugesetzbuch zu beeinflussen und hier mehr Barrierefreiheit zu fordern. Leider sieht das aktuelle Gesetz das Thema Barrierefreiheit überhaupt nicht vor. Man könnte zum Beispiel Barrierefreiheit als eine Aufgabe der Bauleitplanung definieren.
Ich möchte kurz auf die Behauptung eingehen, das sei bereits jetzt der Fall. Bislang steht zum Thema Barrierefreiheit und Bauleitplanung lediglich im Baugesetzbuch, dass die sozialen und kulturellen Bedürfnisse behinderter Menschen berücksichtigt werden müssen. Das ist etwas anderes, als die Anzahl barrierefreier Wohnungen im Rahmen einer Bauleitplanung zu erhöhen. Aus diesem Grund glaube ich, dass hier, im Paragraph 1 Baugesetzbuch, etwas verändert werden müsste.
Wir als Bundesfachstelle haben unter anderem Vorschläge dahingehend unterbreitet, analog zum Umweltbericht einen Barrierefreiheitsbericht im Baugesetzbuch zu verankern. Die Kommunen sind frei, im Rahmen ihrer konkreten Bauleitplanung bestimmte Dinge vorzunehmen, die barrierefreien Wohnraum fördern.
Eine Idee wäre, bei Bebauungsplänen eine Anzahl barrierefreier Wohnungen vorzusehen. Oder man schreibt die Beteiligung kommunaler Behindertenbeauftragter vor. Momentan besagt das Baugesetzbuch, dass bestimmte Behörden bei der Bauleitplanung, also der Aufstellung von Bebauungsplänen, beteiligt werden müssen. Dazu zählen bisher nicht die Beauftragten der Menschen mit Behinderungen auf kommunaler Ebene.
Das sind einige Vorschläge der Bundesfachstelle, wie man dieses Thema weiterentwickeln kann. Mir ist bewusst, dass Bund, Länder und Kommunen gefordert sind. Insofern glaube ich, dass nur ein strukturierter Dialogprozess helfen kann, den eklatanten Mangel an barrierefreien Wohnungen zu beseitigen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.